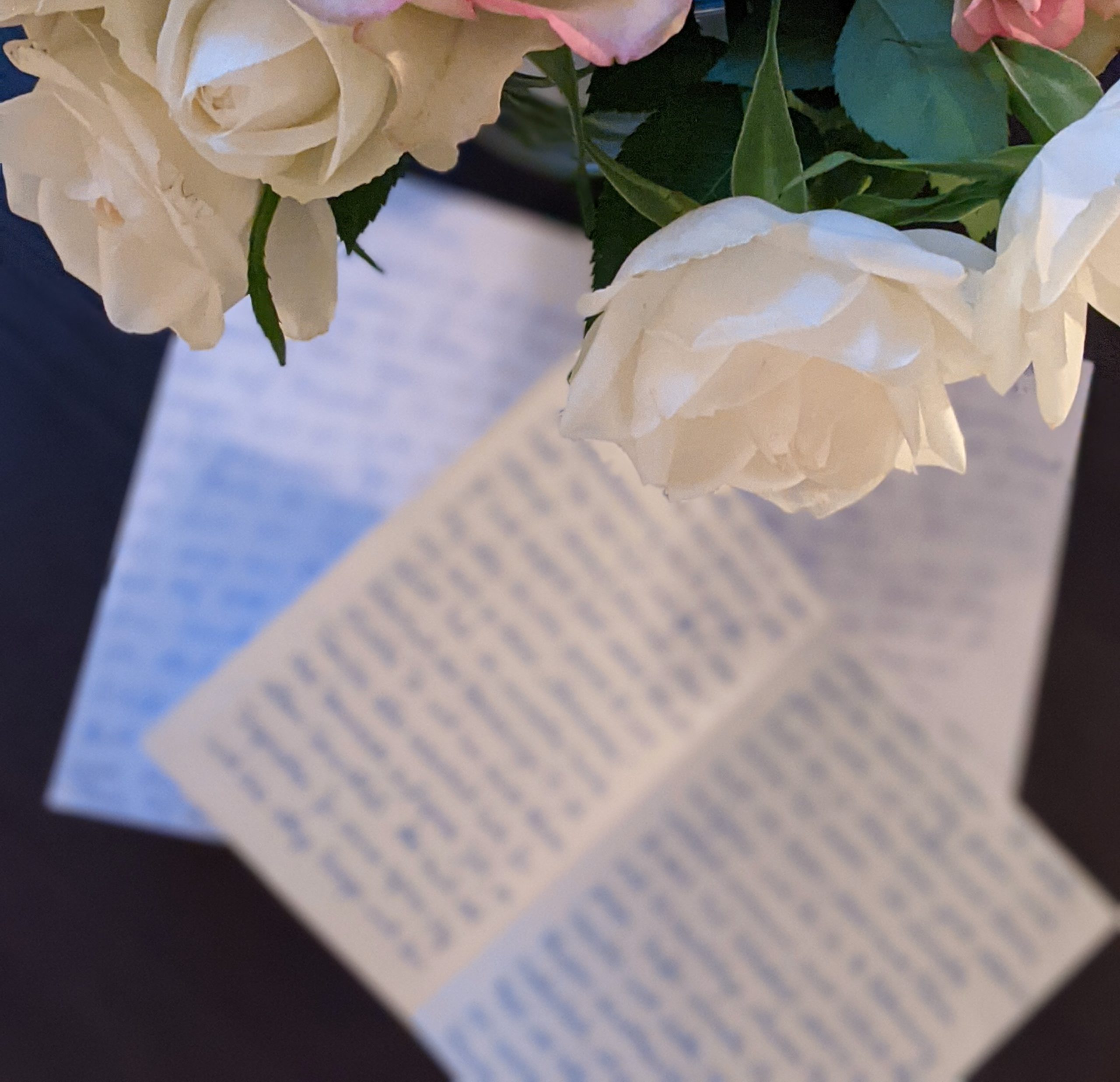Ich sehe sie noch, die krummen, auseinander fliegenden Buchstaben. Die ersten Wortfetzen, geschrieben-wie-man-hört. „um aht ur“, „ih haise palina.“ Der Reiz, das weiße Blatt mit Leben zu füllen, ich spüre ihn heute genauso, wie damals, als ich gelernt habe, mit Stift auf Papier zu kritzeln.
Ich bin mit dem Befüllen der weißen Seiten aufgewachsen. Mein erstes Büchlein duftete nach Rosenseife und hatte ein kleines Schloss mit Spielzeugschlüsseln. Seine pastellfarbenen Seiten bergen naive Berichte über den Kinderalltag, die müßigen Stunden mit Freundinnen, die stillen Nachmittage in den kalten Wintermonaten, wenn sich die Sonne früh nachmittags mit ihren letzten Strahlen verabschiedet. In dieser kleinen Welt sind es nur kleine Dinge, die Sorgen bereiten: der Solfeggio-Unterricht an Montagen oder der ewig nicht schmelzen wollende Schnee im April.

Abgelöst durch dezentere Schreibblöcke, verschwanden die Büchlein in der Schublade. Die neuen Papier-Schatztruhen erfahren von der ersten Verliebtheit, dem ersten richtigen Kummer. Hier tauchen die ersten Fragen auf, die über den Alltagshorizont hinauswachsen, auch wenn die Antworten noch lange nicht in Sicht sind.
„Dem Büroalltag zum Trotz, schwelge ich in Erinnerungen, beschwöre Orte herauf, an denen ich schon lange nicht mehr existiere, führe unaufhörliche Dialoge mit mir selbst.“
Mit der Zeit entschwindet das Kindliche, doch an der Schreiblust ändert es wenig. In Gebrauch kommen Hefte aller Art, kariert, liniert, vergilbt, gebraucht. Hauptsache es schreibt sich nieder, was bewegt. Hier fängt das Leben an zu glühen, zu schmerzen. Ausbruch und Wandel, zumindest auf Papier, bestimmen die Aneinanderreihung an Textsequenzen, mal trotzig, mal sehnsüchtig und melancholisch.
Dann kommen die schlichten, musterlosen Notizbücher voll mit Gedankenschleifen einer Studentin und schließlich Absolventin, die zweifelnd beginnt in die Welt der Arbeit einzutauchen. Häufiger noch haben die Texte nichts mit realen Umständen zu tun. Dem achtstündigen Büroalltag zum Trotz, schwelge ich in Erinnerungen, beschwöre Orte herauf, an denen ich schon lange nicht mehr existiere, führe unaufhörliche Dialoge mit mir selbst. Diese Texte sind fließend-verworren, in einen Schleier aus der eigenen Unreife gehüllt. Ich will, doch ich kann nicht. Ich sehne mich, doch ich weiß nicht wonach.

Wir neigen oft dazu, Dinge und Beschäftigungen, die uns einst so viel Freude schenkten, im Laufe des Erwachsenwerdens auszumisten. Wenn es gut läuft, verschließen wir sie gut verpackt in einem dunklen Schrank namens ‚Kinderspielzeug‘. Manchmal werfen wir diese Päckchen weg, denn wozu sollen sie schon gut sein: Das ausgefranste Springseil, die trüben Aquarellfarben, die abgebrochenen Buntstifte? Wollen wir ernsthaft noch Malen, Fantasieren, Tanzen, Herumalbern, Rennen, Blumen pusten?
„Wir neigen oft dazu, Dinge und Beschäftigungen, die uns einst so viel Freude schenkten, im Laufe des Erwachsenwerdens auszumisten.“
So hielt ich das Schreiben lange unter Verschluss, dass mich ja keiner sah. Ich schrieb mit der vermeintlichen Gewissheit, dass es außer mir niemand zu Gesicht bekommen würde. Ich war doch nicht gut genug. Nachvollziehbar, denn ich las parallel immer Klassiker und hatte hohe Erwartungen an mich selbst.
Heute muss ich darüber schmunzeln. Wir setzen uns manchmal so ungemein hohe Ziele, dass uns als natürliche Reaktion nichts als Lähmung bleibt. Bis vor kurzem habe ich mich nie gefragt, warum ich eigentlich schreibe. Ich dachte über Stile und Richtungen nach, grübelte über Worte und Ausdruck, aber warum tat ich das? Warum zog mich das weiße Blatt überhaupt so an? Warum verspürte ich beim Schreiben ein Ziehen, als würde etwas Außergewöhnliches passieren?
Mit der Zeit wurde ich ehrlicher zum Papier. Die Worte verloren den Dunst einer unerfahrenen, verträumten Seele, kamen nicht mehr in verschnörkelten Sätzen daher. Je mehr ich erkannte, wie viel Klarheit und Einsicht mir das Schreiben schenkt, desto direkter wurden meine Texte. Ich wagte es, mich vor mir selbst zu entblößen und staunte zeitweise über die eigenen Wünsche und Gedanken. Ich lernte meine verborgenen Seiten kennen.

Schreibend wachse ich. Auf einem weißen Blatt kann ich klagen und lachen. Träumen. Erinnerungen wachrufen. Fragen stellen, Antworten suchen und manchmal auch finden. Ich kann unbändig und impulsiv sein, mich ausweinen und mir selbst Mut zusprechen.
Ab und an verwandele ich mich in einen gehässigen Selbstkritiker, um seinen Schatten durch das Niederschreiben loszuwerden. Ich fange Gefühle ein und lasse Menschen los. Notiere den Wandel, um in Sturmzeiten standzuhalten. Ich spinne aus dem Chaos des Lebens einen Faden und halte mich an ihm fest. All das mit geschriebenem Wort auf weißem Blatt.
„Das Schreiben stellt eine Verbindung zu einer existenziellen Ebene, die sich im Alltag kaum zeigt. Ich meine, so fühlt sich rohe Kunst an, frei von Urteil und Lorbeerkränzen.“
Das Schreiben ist ein natürliches Verlangen. Dabei entsteht eine Verbindung zu einer existenziellen Ebene, die sich im Alltag kaum zeigt. Ich meine, so fühlt sich rohe Kunst an, frei von Urteil und Lorbeerkränzen. Das Schreiben stellt für mich den Draht zur Welt her und ich will es heute teilen. Vielleicht wollte ich es schon immer, mit dem ersten Schlüsselbüchlein, dem ersten Gekritzel. Wie es Kindern ganz frei von Grübeleien eigen ist: Schau mal, was ich da gemacht habe!